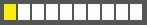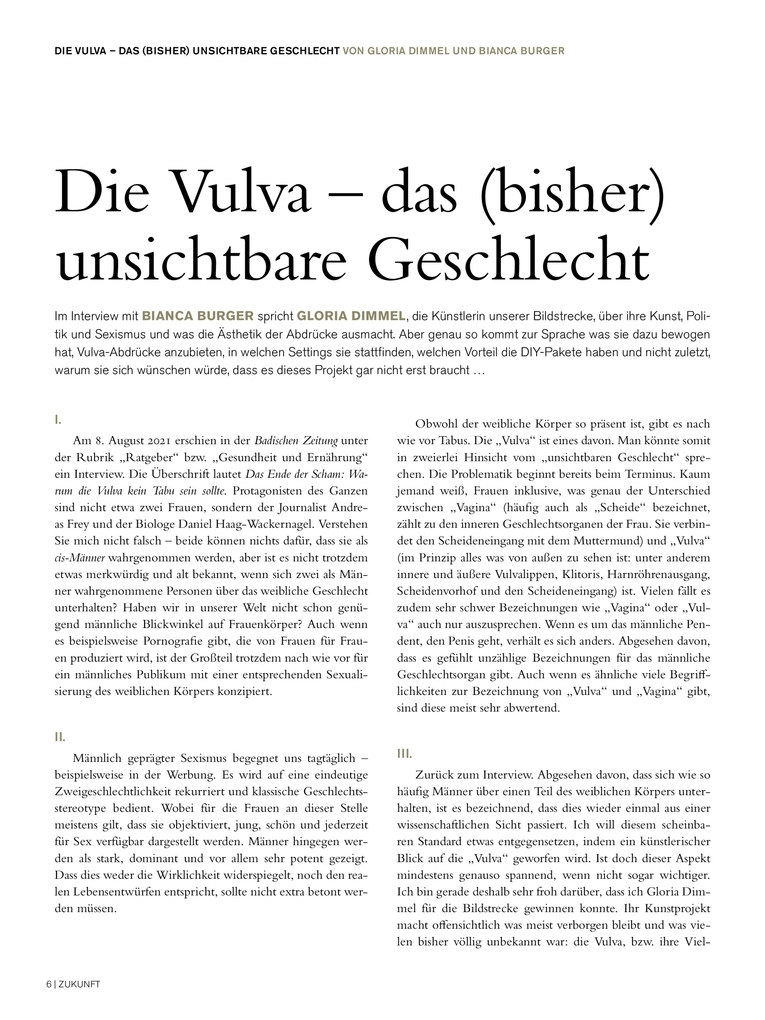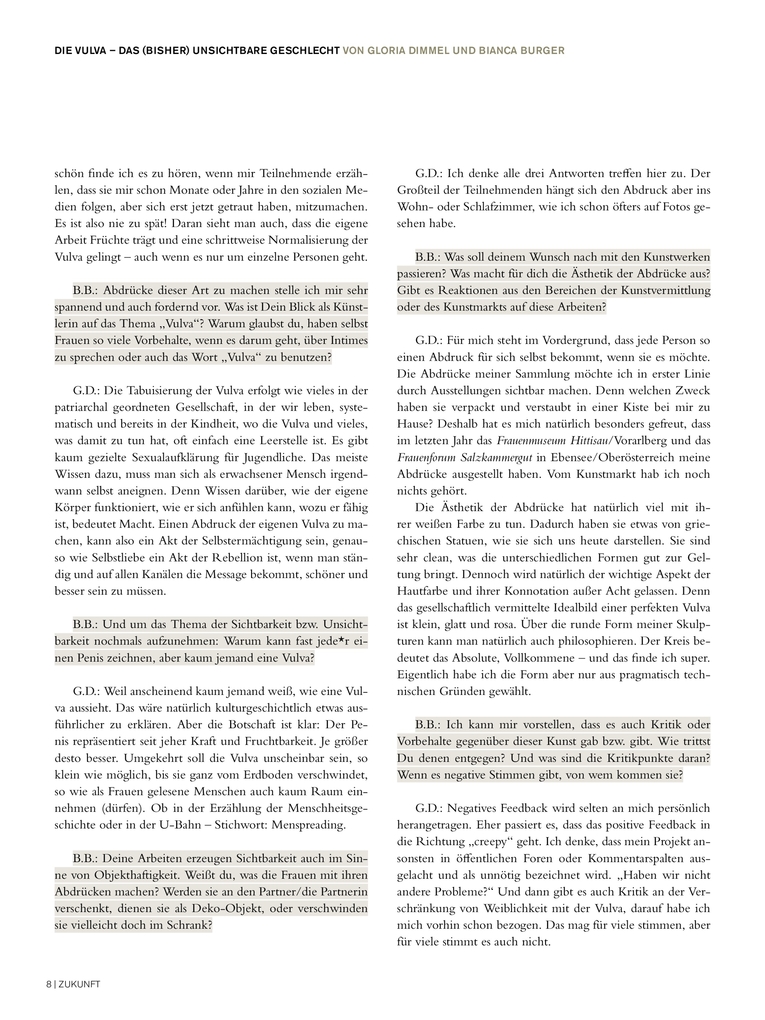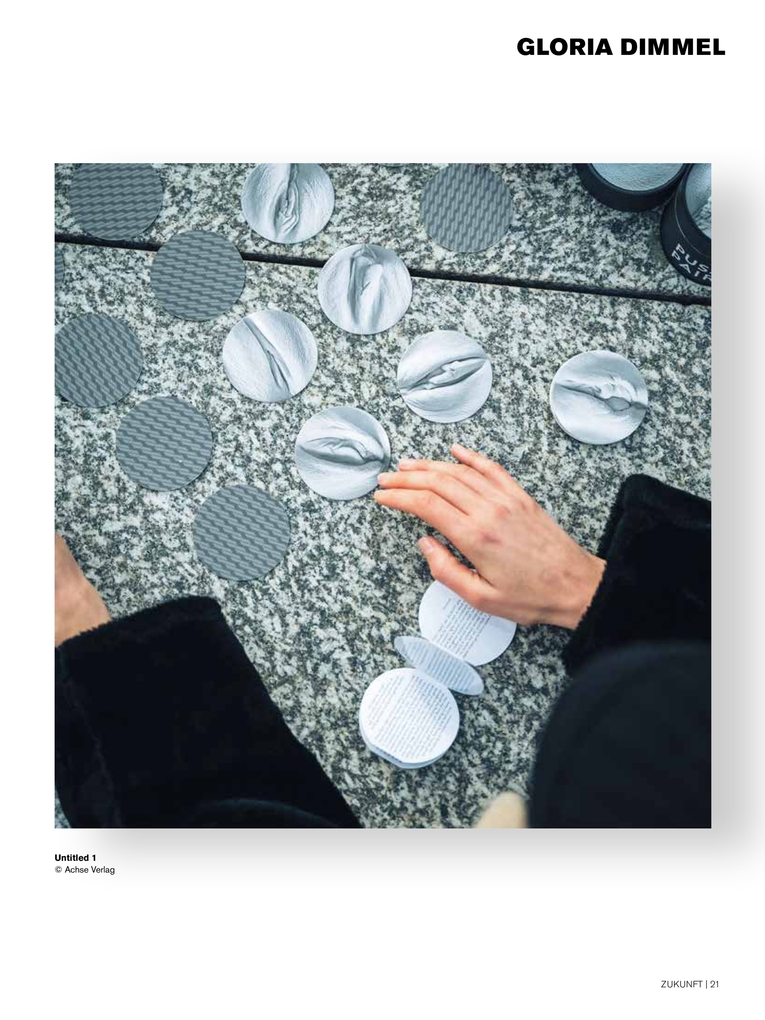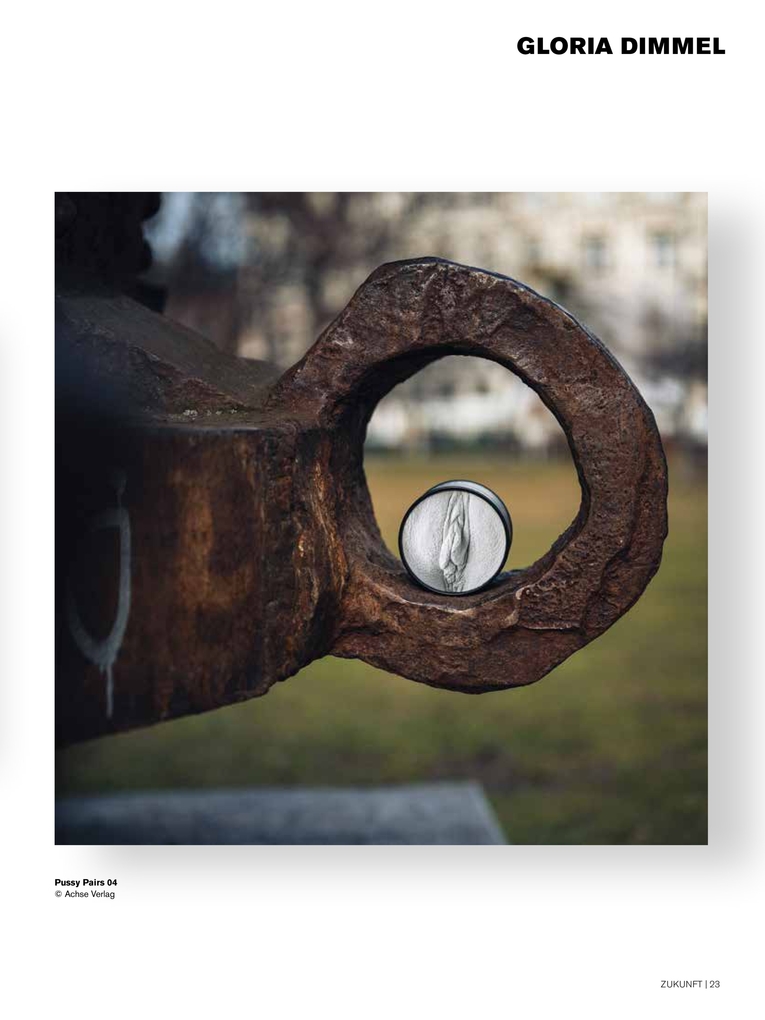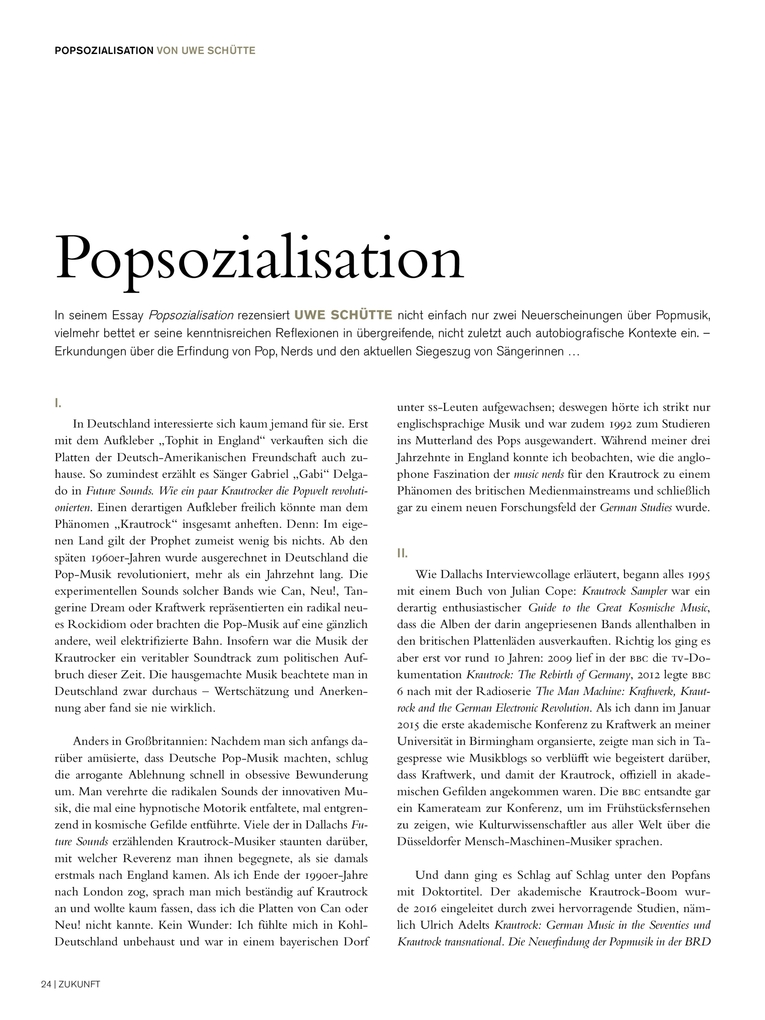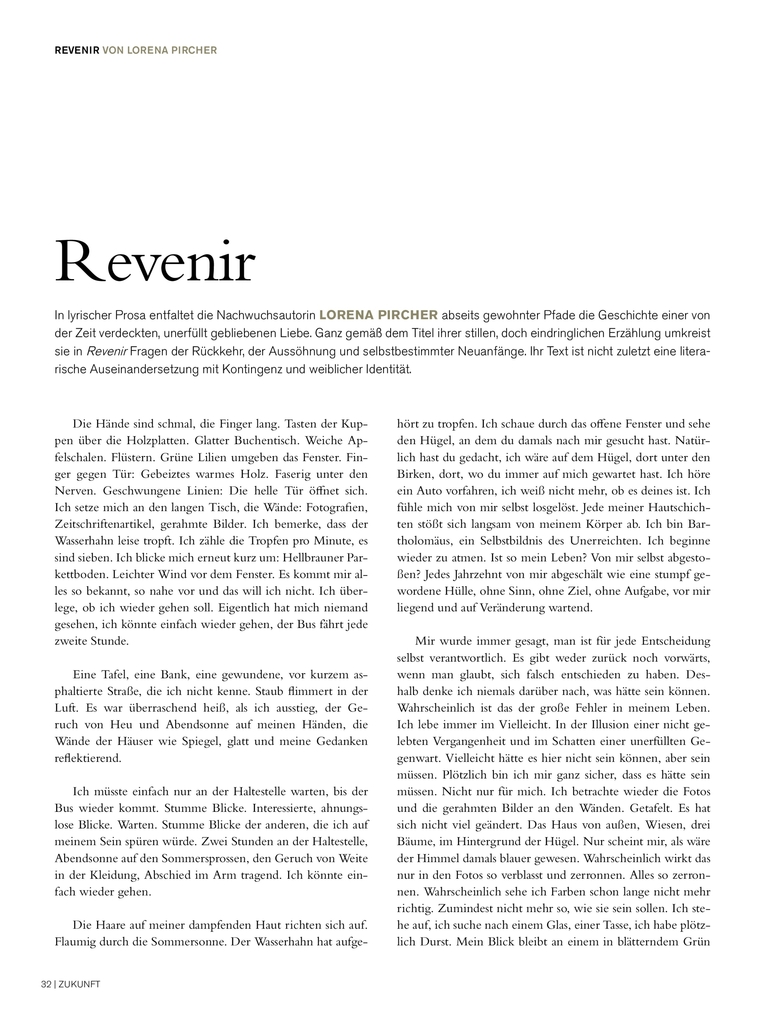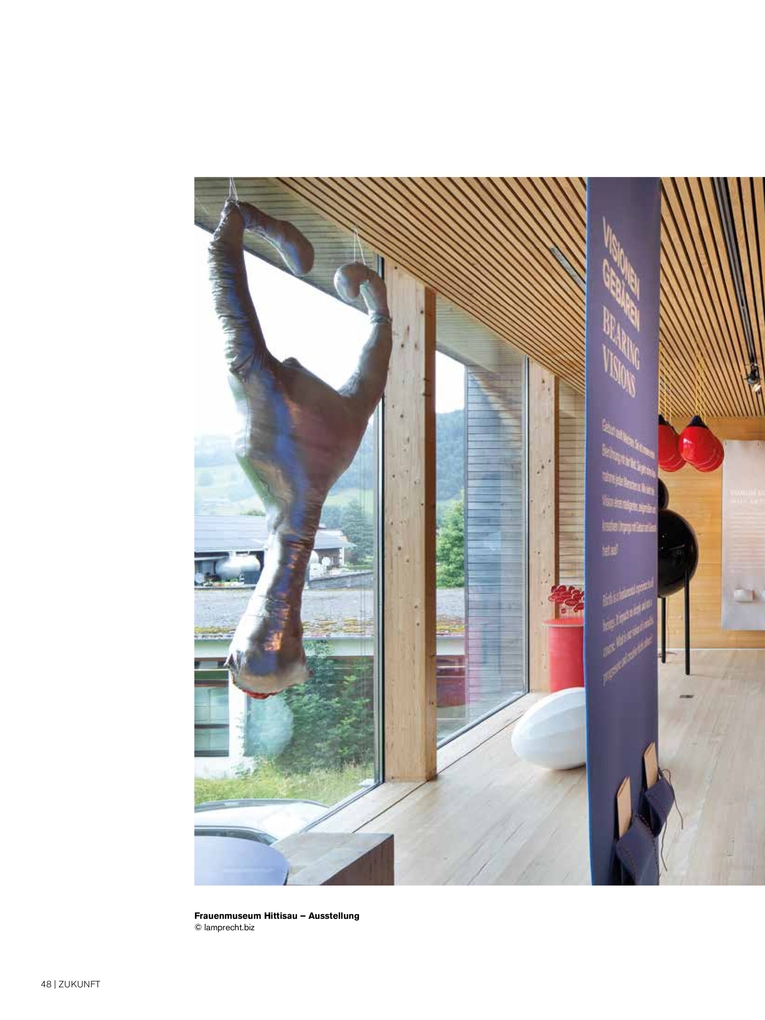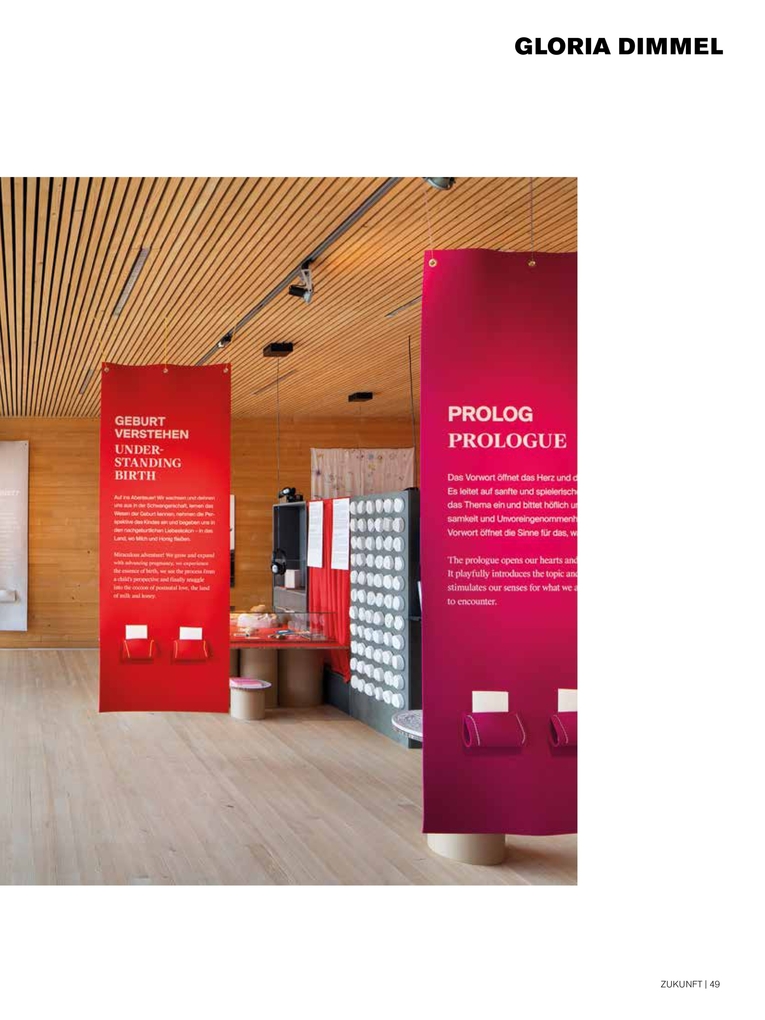ZUKUNFT | 29
bens, bis dann der Zug kommt und seine Tochter steigt aus, die eine Fehlgeburt hatte, und danach hat sie wieder den Kontakt zu ihm aufgenommen und bei ihm wird sie jetzt blei-ben die nächsten Wochen und das Geschehene versuchen zu verarbeiten und sich ihm annähern.
Am Ende der Stunde gebe ich das Papier ab und fahre mit
dem Rad zurück in die leere Wohnung. Natürlich habe ich kein einziges Wort mit Mascha gesprochen und natürlich hat ihr Schulterzucken nicht mir gegolten, sondern dem Kurs all-gemein. Sie hat noch nie mit mir geredet und ich frage mich, was sie eigentlich in diesem Kurs macht, wenn sie doch schon längst ein Drehbuchstudium in London abgeschlossen hat. Ich frage mich, ob sie jemals über mich nachgedacht hat und ob sie sich dann auch fragt, was ich in diesem Kurs mache, die großgewachsene, blasse Stille, die immer alle Aufgaben pünkt-lich und geflissentlich abgibt, aber nie etwas Wesentliches bei-getragen hat zu diesem Short Film Kurs, für den die Filmwis-senschaft mittlerweile bekannt ist.
In der Wohnung toaste ich das Brot von vorgestern und
lege mich mit dem Laptop bäuchlings aufs Bett. Gegenüber von mir die kahle weiße Wand, hinter dem Fenster ist es längst dunkel geworden, der Kurs findet abends statt, die Lichter des Hochhauskomplexes gegenüber tauchen das kleine Zimmer in kaltes, mattes Licht.
Ich rufe Spencers Website auf, sehe mir seinen letzten
preisgekrönten Kurzfilm an. Ich sauge alles auf, verstehe das Ende nicht. Wie hat die Uni ihn als Gastdozenten verpflich-ten können?
Am nächsten Tag sehe ich Mascha durch Zufall auf dem
Campus. Sie hat einen Kaffeebecher in der Hand und ist ganz in schwarz gekleidet, hat ihre Locken unachtsam zusammen-gesteckt. Sie ist allein, läuft langsam auf mich zu, in ihr Handy vertieft. Sie sieht mich nicht.
Ich merke, wie meine Handinnenflächen beginnen zu
schwitzen, ich fühle mich deplatziert, habe sie noch nie au-ßerhalb des Kurses gesehen, habe mir so oft vorgestellt, was sie in ihrer Freizeit macht, mich gefragt, ob sie allein wohnt oder mit jemanden zusammen. Schon mehrmals habe ich sie geg-ooglet, mir ihren Lebenslauf zusammengereimt, die Fotos be-trachtet. Drei ihrer Skripte sind bereits als Kurzfilme produ-ziert worden, ein viertes Projekt ist in Arbeit. Es gibt keine Versionen online, nicht einmal Trailer.
Ich wische die Handinnenflächen an meiner Jeans ab, kra-
me beschäftigt in meiner Umhängetasche.
Als sie an mir vorbeigeht, lächle ich sie an, die Andeutung
eines Lächelns, so als könnte es ein Zufall sein, als würde ich zufällig an etwas Schönes denken, mit den Gedanken ganz woanders. Und gleichzeitig könnte es auch ihr gelten, eine Kontaktaufnahme, Hey, wir sind doch in einem Kurs, was glaubst Du, wird Spencer für die Abschlussprojekte auswäh-len, hast Du auch so viel zu tun, ciao, bis nächsten Dienstag.
Das beides könnte es bedeuten, aber da ist sie schon an
mir vorbeigegangen und ich bin mir gar nicht sicher, ob sie mich überhaupt gesehen, ob sie mich überhaupt wahrgenom-men hat. Der Blick flüchtig, hat mich höchstens gestreift, die Mundwinkel genauso hochgezogen wie meine, genauso zweideutig. Ich wage es nicht, mich nach ihr umzudrehen.
Der Hörsaal zu „New Scandinavian Extremity“ ist voll
wie immer und wie immer sehen wir Filmausschnitte, bei de-nen manche wegschauen müssen.
In dieser Woche verbringe ich ungewöhnlich viel Zeit am
Campus, die Sonne scheint und ich lese die Texte mal drau-ßen, mal in der Bibliothek, beobachte, wie sich die Ersten morgens auf Kaffee und die Letzten abends auf Feierabend-bier treffen. Über dem runden Seminargebäude geht die Son-ne jeden Abend rosa unter, ein Schauspiel, das ich von zu-hause nicht kenne, Farben, die es in meiner Heimatstadt nie gegeben hat.
In den freien Stunden zwischen den Kursen besuche ich
zweimal das kleine Programmkino zwei Straßen weiter, flüch-te mich vor der Mittagshitze in die ausgeleierten Plüschses-sel und lasse die Dunkelheit und die klimatisierte Luft sich auf mich legen. Jedes Mal, wenn der Abspann läuft, frage ich mich, wie das sein muss, wenn Dein eigener Name dort steht, weiß auf schwarz, von unten nach oben wandernd.
Am Dienstagabend wartet Spencer kaum ab, bis wir uns
gesetzt haben. „Ich habe drei Projekte ausgewählt“, sagt er. „Diejenigen, die sie entwickelt haben, sind für das gesamte Skript verantwortlich. Die anderen ordnen sich jeweils den Gruppen zu, diskutiert untereinander, wer welche Rolle ein-nimmt, Kamera, Ton, Supervision, Requisite usw. Schafft ihr das, euch selbst einzuteilen?“ Er zieht umständlich den Over-headprojektor nach vorne, ich starre Maschas Hinterkopf an. Den unteren Haaransatz hat sie wegrasiert. Vielleicht kann ich