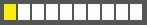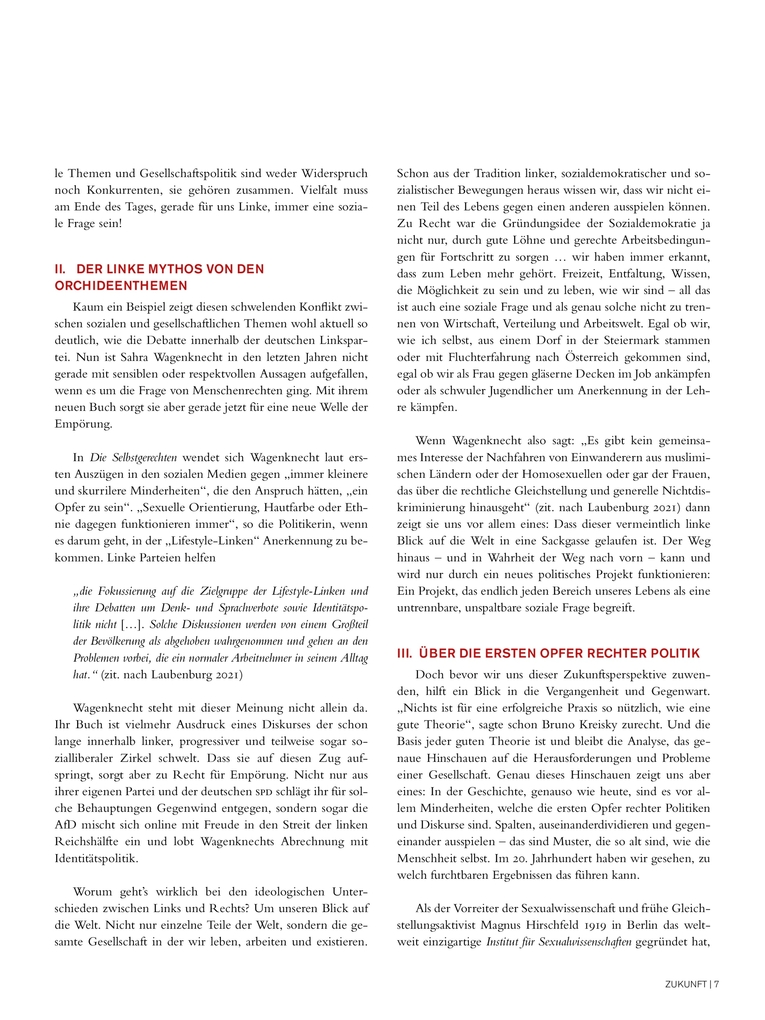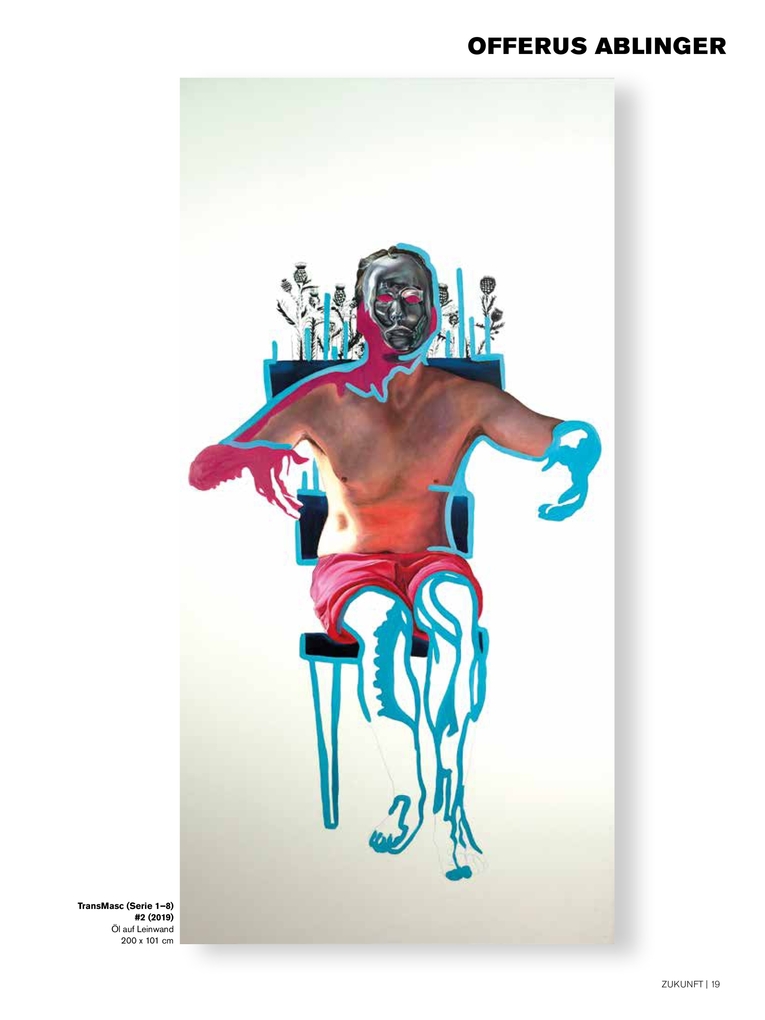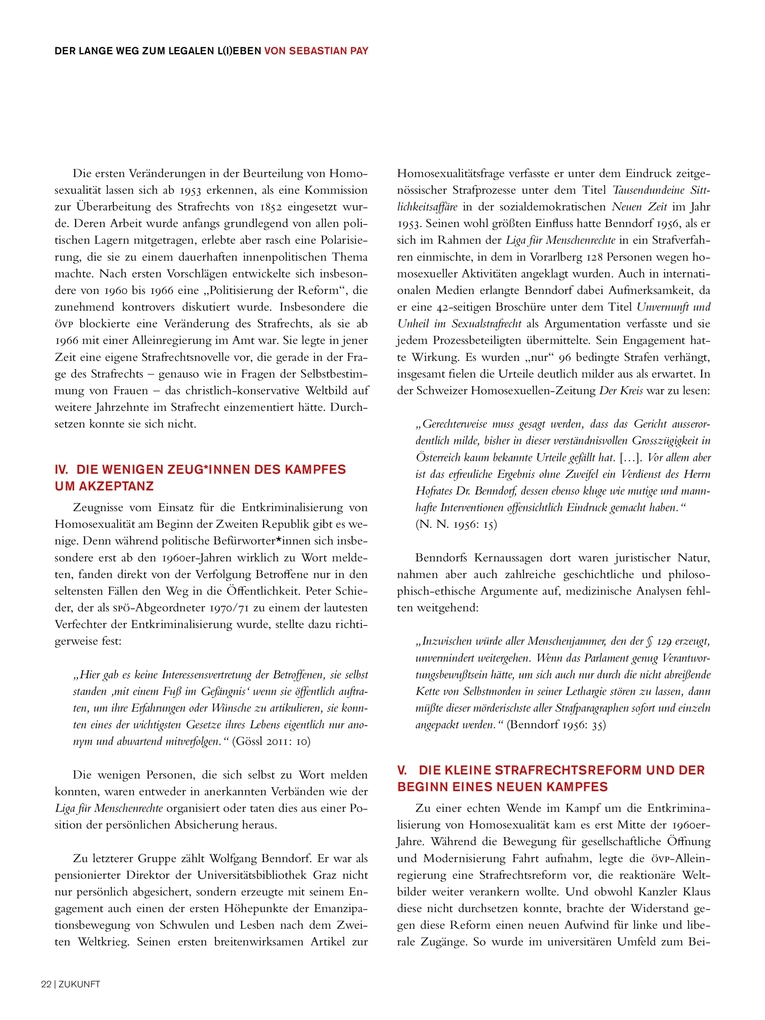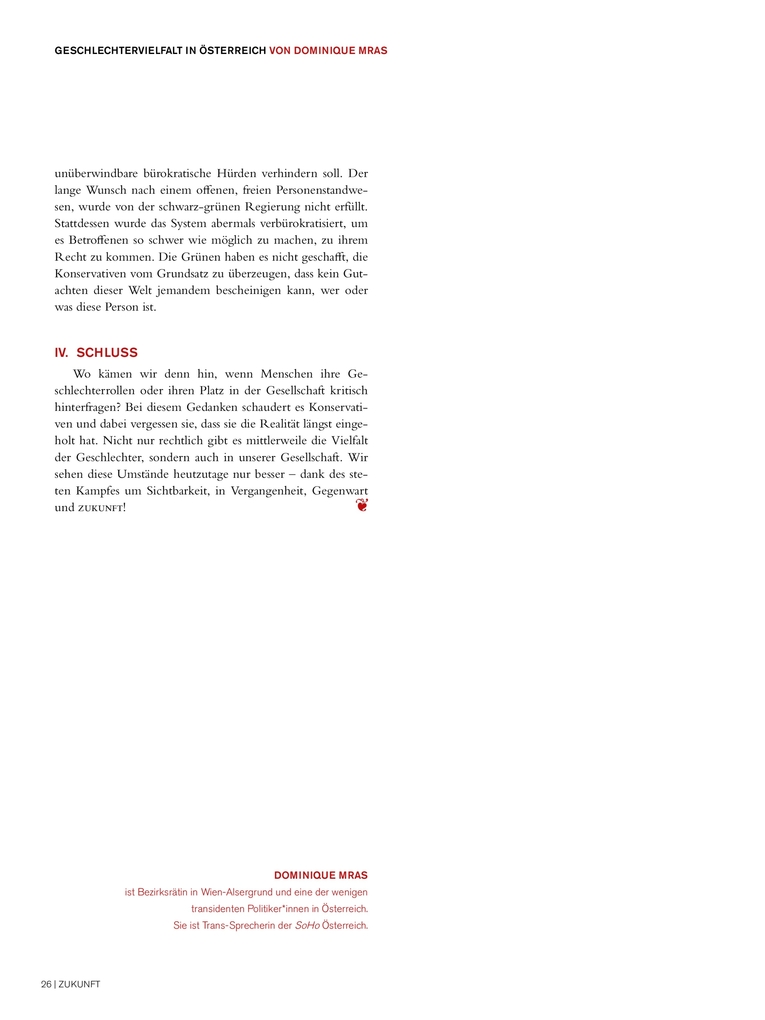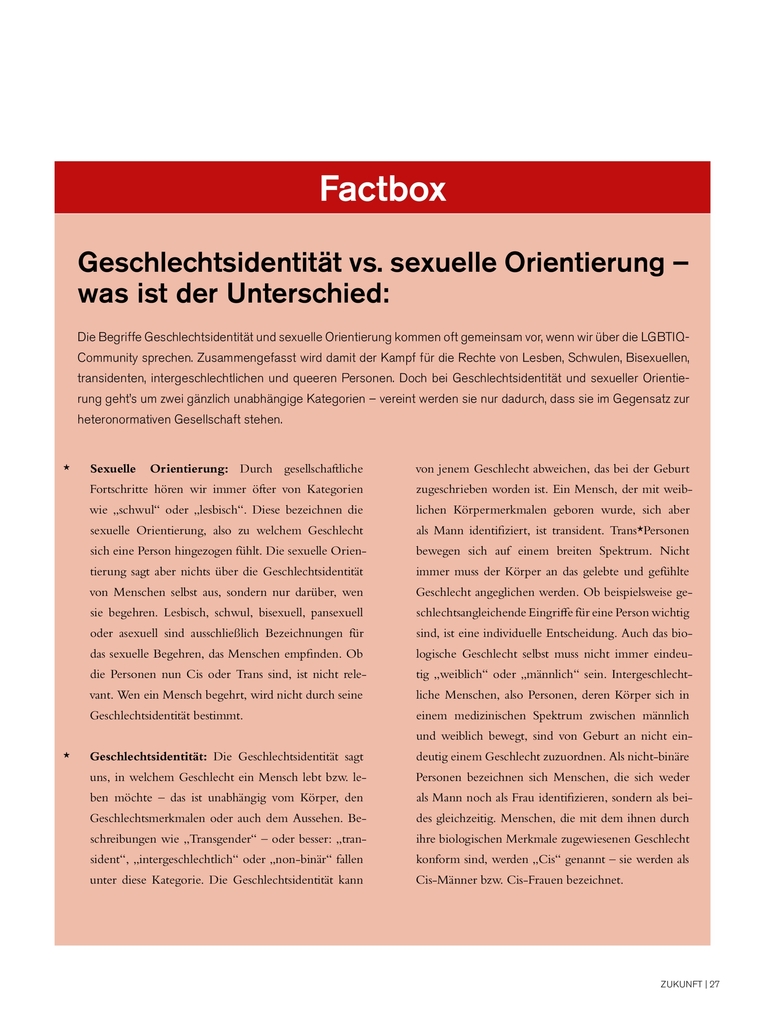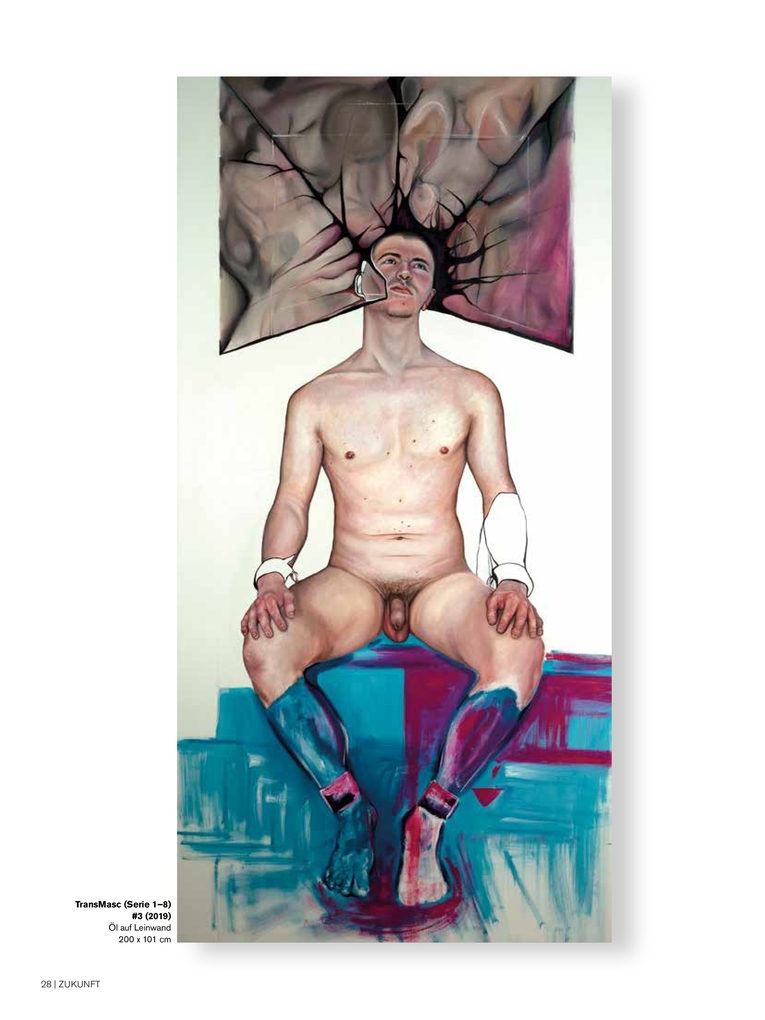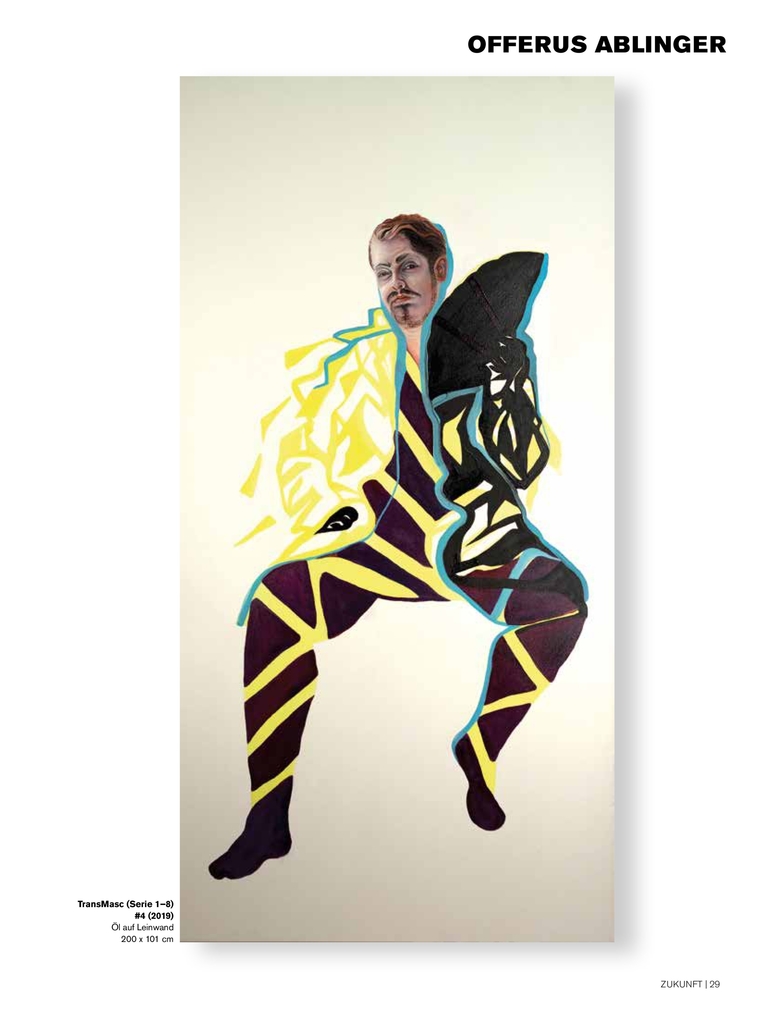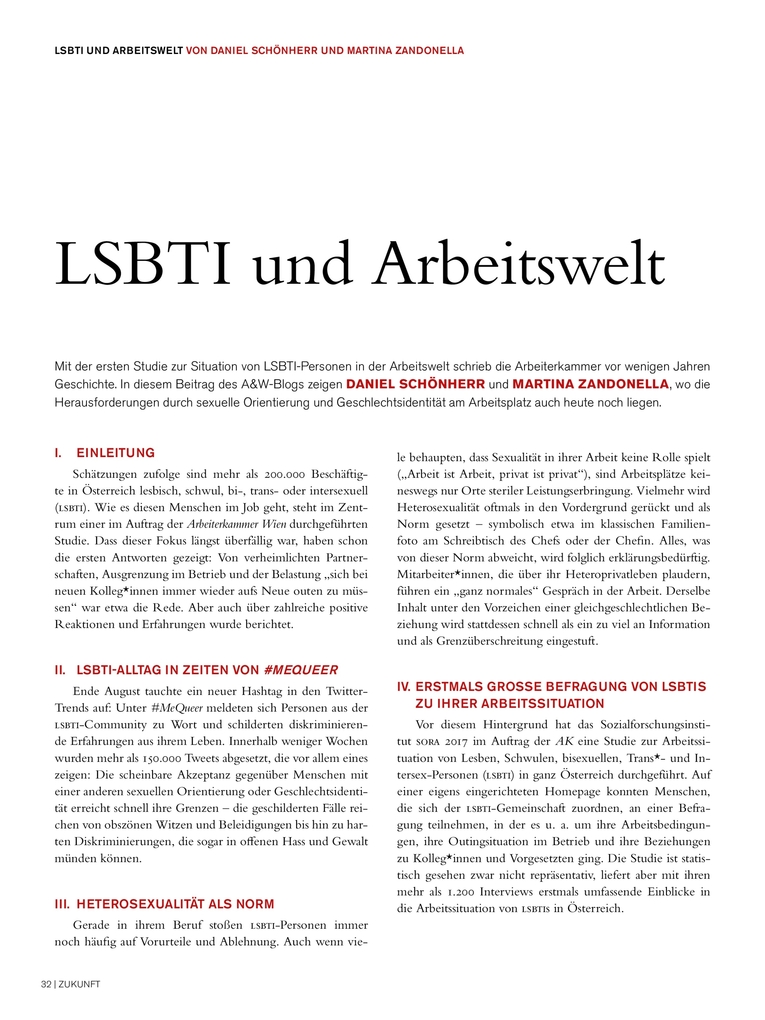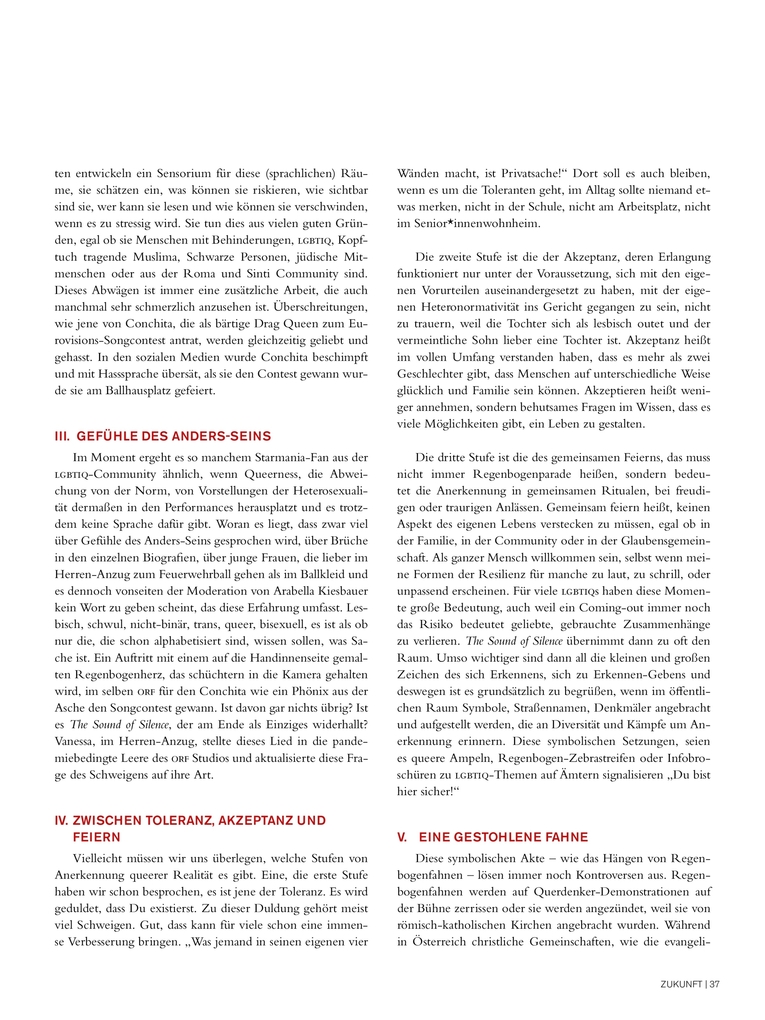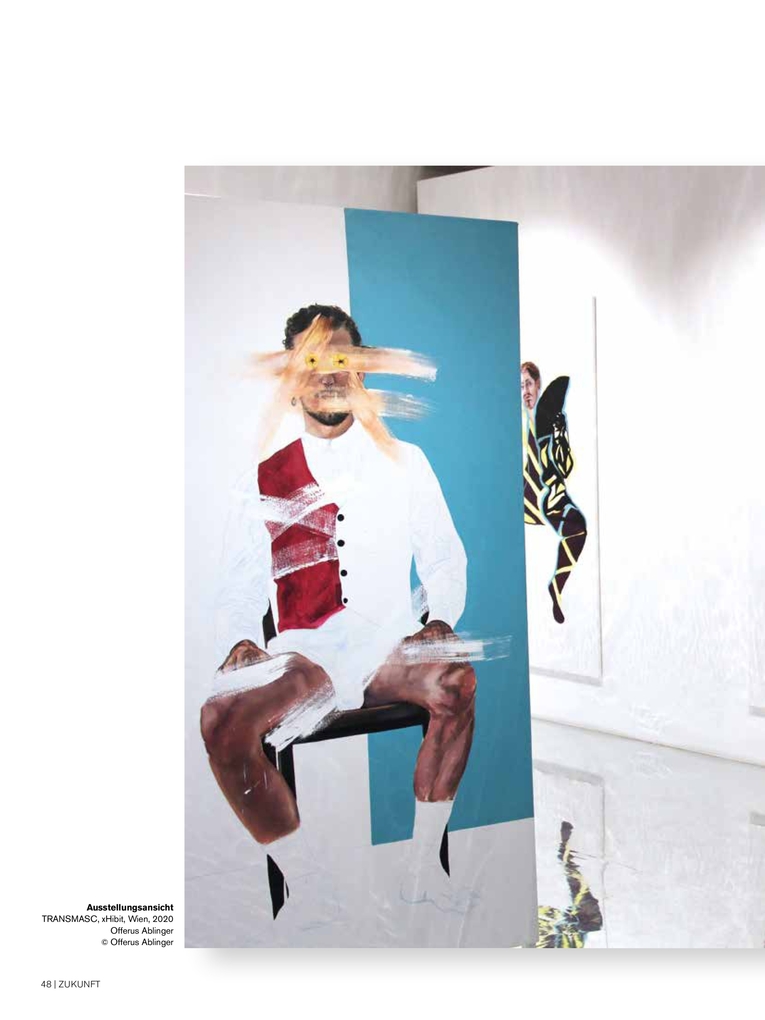ZUKUNFT | 37
ten entwickeln ein Sensorium für diese (sprachlichen) Räu-me, sie schätzen ein, was können sie riskieren, wie sichtbar sind sie, wer kann sie lesen und wie können sie verschwinden, wenn es zu stressig wird. Sie tun dies aus vielen guten Grün-den, egal ob sie Menschen mit Behinderungen, LGBTIQ, Kopf-tuch tragende Muslima, Schwarze Personen, jüdische Mit-menschen oder aus der Roma und Sinti Community sind. Dieses Abwägen ist immer eine zusätzliche Arbeit, die auch manchmal sehr schmerzlich anzusehen ist. Überschreitungen, wie jene von Conchita, die als bärtige Drag Queen zum Eu-rovisions-Songcontest antrat, werden gleichzeitig geliebt und gehasst. In den sozialen Medien wurde Conchita beschimpft und mit Hasssprache übersät, als sie den Contest gewann wur-de sie am Ballhausplatz gefeiert.
III. GEFÜHLE DES ANDERS-SEINS
Im Moment ergeht es so manchem Starmania-Fan aus der
LGBTIQ-Community ähnlich, wenn Queerness, die Abwei-chung von der Norm, von Vorstellungen der Heterosexuali-tät dermaßen in den Performances herausplatzt und es trotz-dem keine Sprache dafür gibt. Woran es liegt, dass zwar viel über Gefühle des Anders-Seins gesprochen wird, über Brüche in den einzelnen Biografien, über junge Frauen, die lieber im Herren-Anzug zum Feuerwehrball gehen als im Ballkleid und es dennoch vonseiten der Moderation von Arabella Kiesbauer kein Wort zu geben scheint, das diese Erfahrung umfasst. Les-bisch, schwul, nicht-binär, trans, queer, bisexuell, es ist als ob nur die, die schon alphabetisiert sind, wissen sollen, was Sa-che ist. Ein Auftritt mit einem auf die Handinnenseite gemal-ten Regenbogenherz, das schüchtern in die Kamera gehalten wird, im selben ORF für den Conchita wie ein Phönix aus der Asche den Songcontest gewann. Ist davon gar nichts übrig? Ist es The Sound of Silence, der am Ende als Einziges widerhallt? Vanessa, im Herren-Anzug, stellte dieses Lied in die pande-miebedingte Leere des ORF Studios und aktualisierte diese Fra-ge des Schweigens auf ihre Art.
IV. ZWISCHEN TOLERANZ, AKZEPTANZ UND
FEIERN
Vielleicht müssen wir uns überlegen, welche Stufen von
Anerkennung queerer Realität es gibt. Eine, die erste Stufe haben wir schon besprochen, es ist jene der Toleranz. Es wird geduldet, dass Du existierst. Zu dieser Duldung gehört meist viel Schweigen. Gut, dass kann für viele schon eine immen-se Verbesserung bringen. „Was jemand in seinen eigenen vier
Wänden macht, ist Privatsache!“ Dort soll es auch bleiben, wenn es um die Toleranten geht, im Alltag sollte niemand et-was merken, nicht in der Schule, nicht am Arbeitsplatz, nicht im Senior*innenwohnheim.
Die zweite Stufe ist die der Akzeptanz, deren Erlangung
funktioniert nur unter der Voraussetzung, sich mit den eige-nen Vorurteilen auseinandergesetzt zu haben, mit der eige-nen Heteronormativität ins Gericht gegangen zu sein, nicht zu trauern, weil die Tochter sich als lesbisch outet und der vermeintliche Sohn lieber eine Tochter ist. Akzeptanz heißt im vollen Umfang verstanden haben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, dass Menschen auf unterschiedliche Weise glücklich und Familie sein können. Akzeptieren heißt weni-ger annehmen, sondern behutsames Fragen im Wissen, dass es viele Möglichkeiten gibt, ein Leben zu gestalten.
Die dritte Stufe ist die des gemeinsamen Feierns, das muss
nicht immer Regenbogenparade heißen, sondern bedeu-tet die Anerkennung in gemeinsamen Ritualen, bei freudi-gen oder traurigen Anlässen. Gemeinsam feiern heißt, keinen Aspekt des eigenen Lebens verstecken zu müssen, egal ob in der Familie, in der Community oder in der Glaubensgemein-schaft. Als ganzer Mensch willkommen sein, selbst wenn mei-ne Formen der Resilienz für manche zu laut, zu schrill, oder unpassend erscheinen. Für viele LGBTIQs haben diese Momen-te große Bedeutung, auch weil ein Coming-out immer noch das Risiko bedeutet geliebte, gebrauchte Zusammenhänge zu verlieren. The Sound of Silence übernimmt dann zu oft den Raum. Umso wichtiger sind dann all die kleinen und großen Zeichen des sich Erkennens, sich zu Erkennen-Gebens und deswegen ist es grundsätzlich zu begrüßen, wenn im öffentli-chen Raum Symbole, Straßennamen, Denkmäler angebracht und aufgestellt werden, die an Diversität und Kämpfe um An-erkennung erinnern. Diese symbolischen Setzungen, seien es queere Ampeln, Regenbogen-Zebrastreifen oder Infobro-schüren zu LGBTIQ-Themen auf Ämtern signalisieren „Du bist hier sicher!“
V. EINE GESTOHLENE FAHNE
Diese symbolischen Akte – wie das Hängen von Regen-
bogenfahnen – lösen immer noch Kontroversen aus. Regen-bogenfahnen werden auf Querdenker-Demonstrationen auf der Bühne zerrissen oder sie werden angezündet, weil sie von römisch-katholischen Kirchen angebracht wurden. Während in Österreich christliche Gemeinschaften, wie die evangeli-